 Die Schlüsselwörter heißen „Rosabel, believe“. So besagt es zumindest die Geschichte, die Kate in ihrem 1982 veröffentlichten Song „Houdini“ vom Album „The Dreaming“ aufgreift. Die Geschichte geht so: Harry Houdini und seine Ehefrau Bess vereinbaren einen Code. Sollte einer von beiden sterben, hätte nur ein „echtes“ Medium von diesem Code wissen und einen Kontakt zu dem Geist des Verstorbenen herstellen können. Auslöser für den Song war offenbar eine Dokumentation über das Leben von Houdini, die im englischen TV ausgestrahlt worden war. Wie sehr Kate die Geschichte fasziniert hat, wird auch im Cover zu „The Dreaming“ deutlich: es zeigt Kate als Bess, wie sie dem Entfesselungskünstler (in diesem Fall Del Palmer) mit einem Kuss den passenden Schlüssel übergibt – „with a kiss, i’d pass the key….“
Die Schlüsselwörter heißen „Rosabel, believe“. So besagt es zumindest die Geschichte, die Kate in ihrem 1982 veröffentlichten Song „Houdini“ vom Album „The Dreaming“ aufgreift. Die Geschichte geht so: Harry Houdini und seine Ehefrau Bess vereinbaren einen Code. Sollte einer von beiden sterben, hätte nur ein „echtes“ Medium von diesem Code wissen und einen Kontakt zu dem Geist des Verstorbenen herstellen können. Auslöser für den Song war offenbar eine Dokumentation über das Leben von Houdini, die im englischen TV ausgestrahlt worden war. Wie sehr Kate die Geschichte fasziniert hat, wird auch im Cover zu „The Dreaming“ deutlich: es zeigt Kate als Bess, wie sie dem Entfesselungskünstler (in diesem Fall Del Palmer) mit einem Kuss den passenden Schlüssel übergibt – „with a kiss, i’d pass the key….“
Was Kate in 3:48 Minuten erzählt, beschreibt Steven Galloway in seinem neu erschienenen Roman „Der Illusionist“ auf 352 Seiten – das Leben von Harry Houdini. Ein lohnenswertes Buch, wenn man die Rezension von Amien Idries liest:
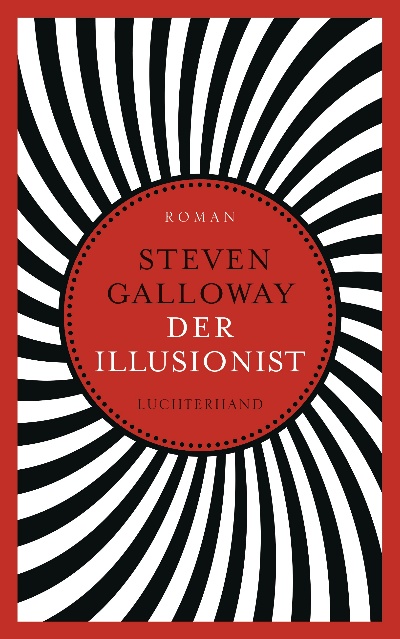 Wie erzählt man von Harry Houdini? Angesichts des übervollen Lebens des Magiers, Entfesselungskünstlers und mutmaßlichen Geheimagenten würde eine profane Biografie zur Fesselung des Lesers wohl reichen. Doch Profanes ist nicht die Sache von Steven Galloway. Der Kanadier erzählt in seinem vierten Roman „Der Illusionist“ so vom Urvater der Magier wie es der Meister wohl selbst gemacht hätte. Er baut Falltüren in die Geschichte ein, lässt den Helden verschwinden, führt mit ungeahnten Wendungen in die Irre und lässt das Publikum, das natürlich weiß, dass alles nur Trickserei ist, mit Fragen zurück. Galloway gelingt dies durch einen erzählerischen Trick. Er lässt den zweiten Handlungsstrang von einem Erzähler bestimmen, der als Erzähler eigentlich gänzlich ungeeignet ist. Martin Strauss lebt in der Gegenwart und ist davon überzeugt, Harry Houdini zwei Mal ermordet zu haben. Das Problem: Strauß wird zu Beginn der Erzählung die Diagnose Konfabulismus unterbreitet (im Original heißt der Roman „The Confabulist“). „Sie haben ein seltenes Leiden, dass die Fähigkeit Ihres Gehirns mindert, Erinnerungen zu speichern. Als Reaktion darauf wird Ihr Gehirn sich neue Erinnerungen ausdenken“, eröffnet ihm ein Arzt, der den bezeichnenden Namen Dr. Korsakoff trägt (das Korsakow-Syndrom beschreibt eine Form der Gedächtnisstörung).
Wie erzählt man von Harry Houdini? Angesichts des übervollen Lebens des Magiers, Entfesselungskünstlers und mutmaßlichen Geheimagenten würde eine profane Biografie zur Fesselung des Lesers wohl reichen. Doch Profanes ist nicht die Sache von Steven Galloway. Der Kanadier erzählt in seinem vierten Roman „Der Illusionist“ so vom Urvater der Magier wie es der Meister wohl selbst gemacht hätte. Er baut Falltüren in die Geschichte ein, lässt den Helden verschwinden, führt mit ungeahnten Wendungen in die Irre und lässt das Publikum, das natürlich weiß, dass alles nur Trickserei ist, mit Fragen zurück. Galloway gelingt dies durch einen erzählerischen Trick. Er lässt den zweiten Handlungsstrang von einem Erzähler bestimmen, der als Erzähler eigentlich gänzlich ungeeignet ist. Martin Strauss lebt in der Gegenwart und ist davon überzeugt, Harry Houdini zwei Mal ermordet zu haben. Das Problem: Strauß wird zu Beginn der Erzählung die Diagnose Konfabulismus unterbreitet (im Original heißt der Roman „The Confabulist“). „Sie haben ein seltenes Leiden, dass die Fähigkeit Ihres Gehirns mindert, Erinnerungen zu speichern. Als Reaktion darauf wird Ihr Gehirn sich neue Erinnerungen ausdenken“, eröffnet ihm ein Arzt, der den bezeichnenden Namen Dr. Korsakoff trägt (das Korsakow-Syndrom beschreibt eine Form der Gedächtnisstörung).
Und so blickt der Konfabulist auf sein Leben zurück – oder das was er dafür hält – und schon ist der Leser mittendrin in einer Geschichte voller Zeitsprünge und Verwirrungspotenzial, in der sich die Lebenswege von Houdini und Strauss mehrmals kreuzen. Wohl wissend, dass einiges faul ist an der Geschichte, lässt sich der Leser darauf ein, was zum einen an Galloways Schreibstil liegt, aber vor allem am Leben Houdinis, das einfach ein ziemlich guter Romanstoff ist. Galloway hat sehr gut recherchiert und nur hier und da Houdinis Leben über die verbrieften Fakten hinaus zugespitzt. Der Leser erfährt von den Anfängen in einer armen Familie, dem ersten Treffen mit seiner künftigen Ehefrau Bess, seiner mutmaßlichen Geheimdienstarbeit und immer wieder von den berühmten Zaubertricks und Entfesselungen des in Ungarn geborenen Juden. Immer spektakulärer müssen diese werden, und Galloway zeigt hier, welche Bedeutung Houdinis Vermarktungskünste für seinen Erfolg gehabt haben. Man sieht gewissermaßen einem der ersten Weltstars bei der Entstehung zu.
Besonders interessant ist die Haltung Houdinis zum Spiritismus, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts in voller Blüte stand. Bis in höchste Regierungskreise glaubte man an Okkultes und Geisterbeschwörungen. Ausgerechnet der Illusionist Houdini aber kämpft gegen den Magieglauben. Durch sein Fachwissen ist er prädestiniert, Hochstaplern das Handwerk zu legen, was er unter wachsender Gefahr tut. Bis heute wird gemutmaßt, sein früher Tod sei auf ein Komplott von Spiritisten zurückzuführen. Wie gesagt, das Leben von Erik Weisz, so Houdinis bürgerlicher Name, war übervoll. Nicht voll genug für Galloway, der den zweiten Erzählstrang des Romans nutzt, um eine philosophische Ebene einzuziehen. Martin Strauss, der Erzähler mit Erinnerungslücken, sitzt in der Gegenwart vor dem Krankenhaus, blickt auf sein Leben und sinniert über das Menschsein. Was ist wahr, was Illusion? Welche Rolle spielt Erinnerung für das Individuum? Ist sie nicht immer Konstrukt, mit dessen Hilfe sich Menschen eine passende Vergangenheit bauen? Sind wir nicht alle im Prinzip Illusionisten, die mit mehr oder minder guten Taschenspielertricks das wahre Ich zu verschleiern versuchen und hoffen, dass selbiges nie zum Vorschein kommt? Vielleicht nicht einmal vor sich selbst. Steven Galloway: „Der Illusionist“. Luchterhand, 352 Seiten, 19.99 Euro.
(Mit bestem Dank an Amien Idries für die freundliche Unterstützung.)


















Neueste Kommentare